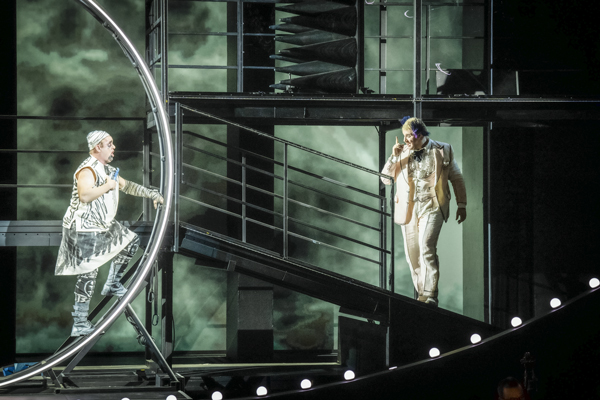Staatenhaus am Rheinpark, Saal 1
Das Rheingold

Das Rheingold
Foto: Matthias Jung

Das Rheingold
Foto: Matthias Jung

Das Rheingold
Foto: Matthias Jung

Das Rheingold
Foto: Matthias Jung

Das Rheingold
Foto: Matthias Jung

Das Rheingold
Foto: Matthias Jung

Das Rheingold
Foto: Matthias Jung

Das Rheingold
Foto: Matthias Jung
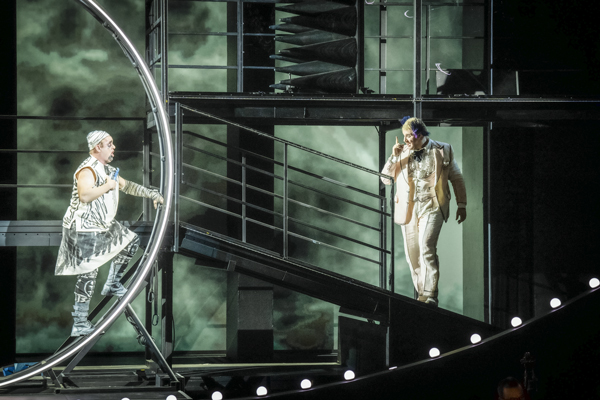
Das Rheingold
Foto: Matthias Jung
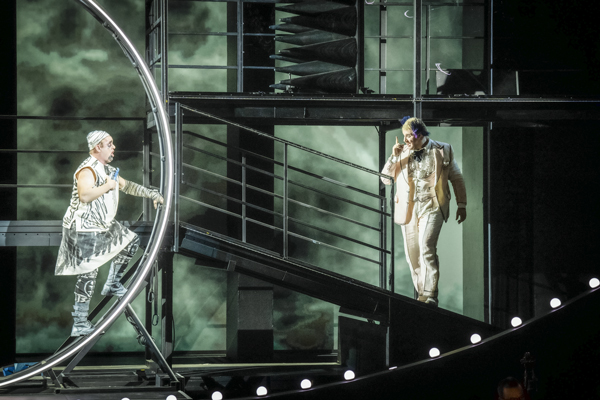
Das Rheingold
Foto: Matthias Jung

Das Rheingold
Foto: Matthias Jung

Das Rheingold
Foto: Matthias Jung
Vorabend zum Bühnenfestspiel DER RING DES NIBELUNGEN
Oper - Richard Wagner
Libretto vom Komponisten
In deutscher Sprache mit Übertiteln
Musikalische Leitung Marc Albrecht
Inszenierung Paul-Georg Dittrich
Bühne Pia Dederichs / Lena Schmid
Kostüme Mona Ulrich
Video Robi Voigt
Licht Andreas Grüter
Dramaturgie Svenja Gottsmann
Personen der Handlung
Wotan, Oberster Gott, Herrscher über Verträge und Gesetze
Fricka, Wotans Gattin, Göttin der Ehe
Freia, Göttin der Jugend und Schönheit
Fasolt und Fafner, Riesen, die für den Bau der Götterburg Walhall Lohn fordern
Loge, Gott des Feuers
Erda, Urmutter und Weissagerin
Donner und Froh, Wotans Brüder, Gott des Donners und Gott der Freude.
Alberich, ein Nibelungenzwerg
Mime, Alberichs Bruder
Die Rheintöchter (Woglinde, Wellgunde, Floßhilde): Bewacherinnen des Rheingoldes
Handlung
Am Grunde des Rheins hüten die Rheintöchter das Gold. Alberich begehrt sie vergeblich; aus Spott verraten sie ihm, dass derjenige, der der Liebe entsagt, das Gold rauben und daraus einen allmächtigen Ring schmieden könne. Alberich vollzieht diesen Liebesverzicht, entreißt das Gold und beginnt seine Herrschaft in der Unterwelt. Wotan und Fricka betrachten die neu erbaute Götterburg Walhall, die die Riesen Fasolt und Fafner errichtet haben. Doch der Preis ist hoch: als Lohn wurde Freia verpfändet. Wotan sucht nach Auswegen, da ohne Freias Äpfel die Götter altern würden. Loge schlägt vor, Alberichs Gold als Ersatz zu gewinnen. Die Riesen erklären sich einverstanden: Bringen Wotan und Loge den Schatz, wollen sie auf Freia verzichten. In der Nibelungenwelt zwingt Alberich sein Volk zur Arbeit am Goldschatz und schmiedet den Ring. Mit Tarnhelm und Peitsche unterdrückt er sie grausam. Wotan und Loge locken Alberich durch List dazu, die Macht des Tarnhelms zu erproben. Als er sich in ein Tier verwandelt, fangen sie ihn und entreißen ihm Ring und Schatz. Verzweifelt verflucht Alberich den Ring: er soll jedem Besitzer Unheil bringen. Die beiden Götter kehren zurück zur Erdoberfläche und treffen Fasolt und Fafner. Die Riesen bestehen auf dem Gold als Ausgleich für ihre Leistung. Als Wotan den Ring behalten will, erscheint Erda und warnt ihn eindringlich. Er gibt nach. Fasolt und Fafner teilen die Beute, wobei Fafner seinen Bruder erschlägt – der Fluch erfüllt sich sofort. Nun ziehen die Götter in Walhall ein, während die Rheintöchter klagend ihr Gold zurückfordern. Ein gewaltiger Regenbogen spannt sich als Brücke über den Rhein, doch die Vorahnung künftigen Unheils liegt schwer über der Szene.
Zum Werk
„Das Rheingold“ ist der Vorabend zu Wagners monumental angelegter Tetralogie Der Ring des Nibelungen. Die ersten Skizzen entstanden in den frühen 1850er-Jahren, komponiert wurde die Oper 1853/54, die Uraufführung erfolgte 1869 in München unter König Ludwig II., gegen Wagners ursprünglichen Plan, den gesamten Zyklus erst vollständig zu präsentieren. Das Werk markiert den Beginn eines einzigartigen musikdramatischen Projekts des 19. Jahrhunderts, das mythische Stoffe germanischer und nordischer Tradition mit zeitkritischen Reflexionen verbindet – etwa über Macht, Gier und den zerstörerischen Umgang mit natürlichen Ressourcen. Die Reaktionen nach der Uraiührung waren geteilt: Während Wagnerianer in dem Werk die Erfüllung einer neuen dramatischen Kunstform sahen, empfanden Kritiker die endlosen deklamatorischen Szenen und das Fehlen traditioneller Opernnummern als Zumutung. Doch gerade diese Abkehr vom Konventionellen markiert den entscheidenden Fortschritt: die Geburt des modernen Musikdramas.
Zur Musik
Wagners Musikästhetik im „Rheingold“ unterscheidet sich grundlegend von der traditionellen Nummernoper. Rezitativ und Arie verschmelzen zu einem ununterbrochenen „durchkomponierten“ Fluss, getragen von einem hoch differenzierten Orchestersatz. Leitmotive – charakteristische musikalische Einfälle, die
Figuren, Objekte oder Ideen zugeordnet sind – bilden das strukturelle Rückgrat. So erklingt etwa das strömende Es-Dur-Arpeggio zu Beginn als musikalisches Bild des Rheins, oder das markante Motiv des Rings, das sich im weiteren Zyklus bedrohlich entfaltet. Das Orchester übernimmt dabei eine gleichberechtigte, ja oft führende Rolle: Es kommentiert, enthüllt verborgene Bedeutungen und verknüpft Handlungsebenen. Zugleich zeugt die Musik von Wagners Idee des Gesamtkunstwerks, in dem Dichtung, Musik und szenische Vision zu einer Einheit verschmelzen. Historisch betrachtet markiert „Das Rheingold“ den Aufbruch in die Spätromantik, doch weist es zugleich voraus auf Entwicklungen des 20. Jahrhunderts. Die Dichte der motivischen Arbeit und die chromatische Harmonik prägen das moderne Musiktheater nachhaltig. Zugleich bleibt das Werk ein Zeitzeugnis: Es reflektiert den Umbruch eine Epoche, in der industrielle und gesellschaftliche Spannungen die Frage nach Macht, Besitz und Schuld neu aufwarfen.
Sebastian Jacobs
DruckenSpielstätteninfo

 So funktioniert´s
Ihre Vorteile
Eine tolle Geschenkidee!
Mitglieder werben Mitglieder
Häufige Fragen
Teilnahmebedingungen
So funktioniert´s
Ihre Vorteile
Eine tolle Geschenkidee!
Mitglieder werben Mitglieder
Häufige Fragen
Teilnahmebedingungen
 Instagram
Instagram